Willkommen beim CDF!
Weil Sie sich über einen Dalmatiner informieren wollen, einen vierbeinigen Freund, Sportkameraden oder Familienzuwachs suchen, haben Sie sich an diese Internet-Seiten des Club für Dalmatiner-Freunde e.V. (CDF) gewandt.
Der CDF ist ein Mitgliedsverein des Dachverbandes für das deutsche Hundewesen (VDH). Wir sind ein relativ kleiner, aber vergnügter Verein und würden uns freuen, wenn Sie an unserem Hobby Interesse finden würden.

Der Club für Dalmatiner-Freunde e.V. (CDF) ist Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e.V.
Der VDH ist die Interessenvertretung aller Hundehalter in Deutschland. Als Dachorganisation von bundesweit 176 Mitgliedsvereinen repräsentiert der Verband mehr als 650.000 Mitglieder.
Über 250 verschiedene Hunderassen werden in den Zuchtvereinen des VDH betreut und unter strengsten Kontrollen gezüchtet. Der VDH und seine Mitgliedsvereine haben sich im internationalen Vergleich – seit jeher – für ein äußerst strenges Zuchtreglement entschieden. Die entsprechenden Richtlinien legen den höchsten Stellenwert auf die Gesundheit der Hunde und den Tierschutz. Als große Interessengemeinschaft, als traditionsreiche Institution und als Gütesiegel ist der VDH der erste Ansprechpartner bei allen Themen rund um den Hund.
Weitere Informationen VDH erhalten Sie unter: www.vdh.de
Ansprechpartner
1. Vorsitzender: Michael Jäger
Obere Lauterstr. 21
67731 Otterbach0 63 01 / 30 00 50
Fax 0 63 01 / 30 00 52
1.vorsitzender@cdf-dalmatinerverein.de
2. Vorsitzender: Thomas Höppner
Am Sprung 8
50181 Bedburg0 22 72 / 83 83 64
Fax 0 22 72 / 83 83 62
2.vorsitzender@cdf-dalmatinerverein.de
Zuchtleiter: Jutta Busser-Henschke
Wasserberg 2
33142 Büren
Zuchtbuchamt: Ramona Niehoff
Talstraße 15a
66894 Bechhofen
Schatzmeister: Helge Hilpert
Am Wingertsberg 3
55278 Köngernheim0 67 37 / 85 11
Fax 0 67 37 / 71 29 94
schatzmeister@cdf-dalmatinerverein.de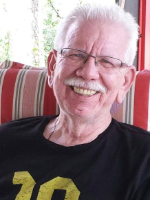
Geschäftsstelle: Lucia Winterberg
Osterheider Straße 42
32479 Hille
Ausstellungen: Lucia Winterberg
Osterheider Straße 42
32479 Hille
West: Monika Burgemeister
Kruckelerstr. 214
44227 DortmundMitte-Nord: Peter Henschke
Wasserberg 2
33142 BürenSüd-West: Mirjam Arck
Lölsberg 13a
51491 Overath
RA Frank Richter, Kastanienweg 75a , D-69221 Dossenheim
Beisitzer: Frau Mirjam Arck, Herr Peter Henschke
Webmaster: Thomas Arnold
Äpfelbach 8
91349 Egloffstein


















